HIV/Aids ist kein fernes Thema, sondern betrifft Menschen direkt hier in Deutschland. Wenn man mit dem Team von Maisha e.V. spricht, wird sofort klar: Es geht um Vertrauen, um Zugang zu Gesundheitsversorgung und Hürden, die durch oder fehlende Sensibilität entstehen.
Eine zweiteilige Blogbeitragreihe von ONE-Jugendbotschafterin Milona Msgna Weldemariam.
Jedes Jahr im Herbst finden die Politikdialogtage von ONE in Berlin statt. Dort treffen ONE-Jugendbotschafter*innen Abgeordneten, um über globale Gesundheit, Geschlechtergerechtigkeit und faire Haushaltsmittel zu sprechen. Ein Fokusthema im Jahr 2025: HIV und Aids.
Begleitend veröffentliche ich eine Mini-Serie in zwei Blogbeiträgen: Der erste Teil gibt Einblicke in die Arbeit von Maisha e. V., einem Gesundheits- und Sozialzentrum für afrikanische Migrant*innen in Frankfurt a.M. Der zweite Teil beleuchtet die internationale Ebene und politische Verantwortung. Die Antworten von Maisha e. V. wurden schriftlich übermittelt und von mir für diesen Beitrag redaktionell zusammengefasst.
Wer ist Maisha e. V.?
Maisha e. V. existiert seit über 25 Jahren und unterstützt afrikanische Migrant*innen in Deutschland. Die Organisation arbeitet zu den Themen Gesundheit, Prävention und HIV/Aids, Frauenrechten, weiblicher Genitalverstümmelung (FGM) und Integration. Besonders wichtig ist dem Team eine kultursensible und mehrsprachige Beratung, die Frauen und Mädchen stärkt, die in mehrfacher Hinsicht mit Barrieren konfrontiert sind.
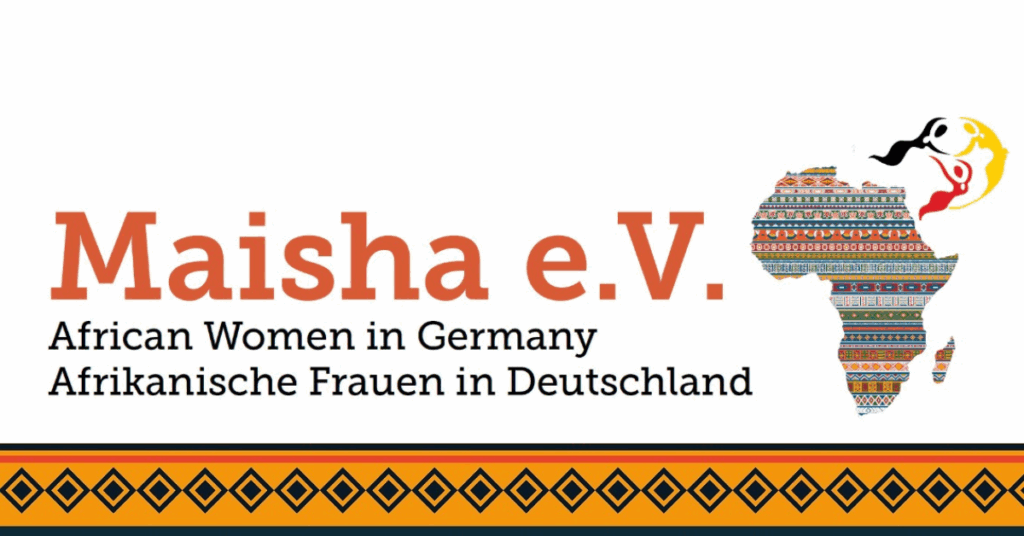
Wie erleben afrikanische Migrant*innen in Deutschland das Thema HIV/Aids?
Maisha e. V.: Afrikanische Migrant*innen sind in besonderer Weise von HIV betroffen, sowohl in Bezug auf das Infektionsrisiko als auch in der Auseinandersetzung mit Stigma und Diskriminierung. Viele erleben Scham, Schuldgefühle und gesellschaftliche Ausgrenzung, was den offenen Umgang mit der Erkrankung erschwert. Rassistische Vorurteile verschärfen diese Situation, weil afrikanische Communities häufig pauschal mit HIV in Verbindung gebracht werden. Das führt zu Misstrauen und Angst im Alltag und im Kontakt mit dem Gesundheitssystem. Ein weiterer Aspekt ist die Verknüpfung mit weiblicher Genitalverstümmelung. FGM kann das Risiko einer HIV-Übertragung erhöhen, sowohl durch unsichere Praktiken bei der Durchführung als auch durch gesundheitliche Folgen wie Gewebeverletzungen, die Infektionen begünstigen. Betroffene Frauen sind dadurch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch mehrfach belastet und benötigen spezifische Unterstützung.
Mit welchen Hürden im Gesundheitssystem haben besonders Frauen zu kämpfen?
Maisha e. V.: Frauen stoßen auf vielfältige Hindernisse. Sprachliche Barrieren erschweren den Zugang zu Prävention, Beratung und Behandlung. Es gibt zu wenige kultursensible Angebote, die medizinische und psychosoziale Bedürfnisse berücksichtigen. Abhängigkeiten von Partnern oder Familienstrukturen führen oft dazu, dass Frauen ihre eigene Gesundheit nicht priorisieren oder gar nicht selbstbestimmt handeln können. Viele Frauen haben Angst vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen und verzichten deshalb auf medizinische Hilfe. Für Frauen, die von FGM betroffen sind, kommt erschwerend hinzu, dass ihre gesundheitliche Situation häufig nicht erkannt oder nicht adäquat behandelt wird. Außerdem berichten viele afrikanische Frauen von Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitssystem, sei es durch stereotype Zuschreibungen, mangelnde Sensibilität von Fachpersonal oder ungleiche Behandlung im Vergleich zu anderen Patientinnen. Das führt oft dazu, dass medizinische Angebote nicht genutzt werden und das Vertrauen in das System sinkt.
Wie kann die Politik in Deutschland Menschen mit afrikanischen Wurzeln besser unterstützen?
Maisha e. V.: Wir wünschen uns mehrsprachige und niedrigschwellige Informations- und Präventionsangebote, die gezielt auch afrikanische Communities erreichen. Außerdem braucht es eine stärkere Förderung kultursensibler Beratungs- und Unterstützungsstrukturen, insbesondere für Frauen, die von HIV oder FGM betroffen sind. Menschen sollten unabhängig vom Aufenthaltsstatus Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten. Wir fordern gezielte Strategien gegen Rassismus und Diskriminierung im Gesundheitssystem. Wichtig sind auch Aufklärungskampagnen, die sowohl HIV als auch FGM thematisieren und die Schnittstellen sichtbar machen. Schließlich sollten Selbstorganisationen wie Maisha e. V., die aus der Community herausarbeiten, gezielt gefördert werden. Wir sind überzeugt, dass ein offener und diskriminierungsfreier Umgang mit HIV und Aids nur möglich ist, wenn Politik, Zivilgesellschaft und Communities eng zusammenarbeiten und wenn die Erfahrungen von Rassismus und FGM mitgedacht werden.
Wie der Globale Fonds HIV/Aids bekämpft
Die Perspektive von Maisha e. V. macht deutlich, wie eng globale Gesundheit und lokale Realitäten miteinander verflochten sind. Frauen und Mädchen in Subsahara-Afrika sind weltweit überproportional von HIV betroffen – nicht nur aufgrund biologischer Faktoren, sondern vor allem wegen ungleicher Machtverhältnisse, ökonomischer Abhängigkeiten und geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähnliche Dynamiken zeigen sich auch in Deutschland: Sprachbarrieren, Erfahrungen mit FGM oder Diskriminierung erhöhen hier die Verwundbarkeit von Frauen mit Migrationsgeschichte.
Besonders eindrücklich ist, wie sehr Stigma und Ausgrenzung das Leben von Betroffenen prägen. Zwar ist HIV heute gut behandelbar, doch Angst vor Diskriminierung hält viele Menschen davon ab, sich testen zu lassen oder Hilfe in Anspruch zu nehmen. Damit wird deutlich: Gesellschaftliche Barrieren können genauso schwer wiegen wie die Krankheit selbst. Maisha zeigt, dass es nicht allein um Medikamente geht, sondern um Strukturen, die Vertrauen schaffen und echte Zugänge ermöglichen.
Genau an diesem Punkt setzen internationale Programme wie der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria an. Sie stärken Gesundheitssysteme, bauen Diskriminierungsbarrieren ab und sichern lebenswichtige Therapien. So erhielten 2023 allein 25 Millionen Menschen eine antiretrovirale HIV-Behandlung durch die Unterstützung des Fonds. Umso alarmierender ist es, dass Deutschland seine Beiträge kürzen will. Stattdessen sollte die Bundesregierung Verantwortung übernehmen und mindestens 1,3 Milliarden Euro zur nächsten Wiederauffüllung beitragen.

