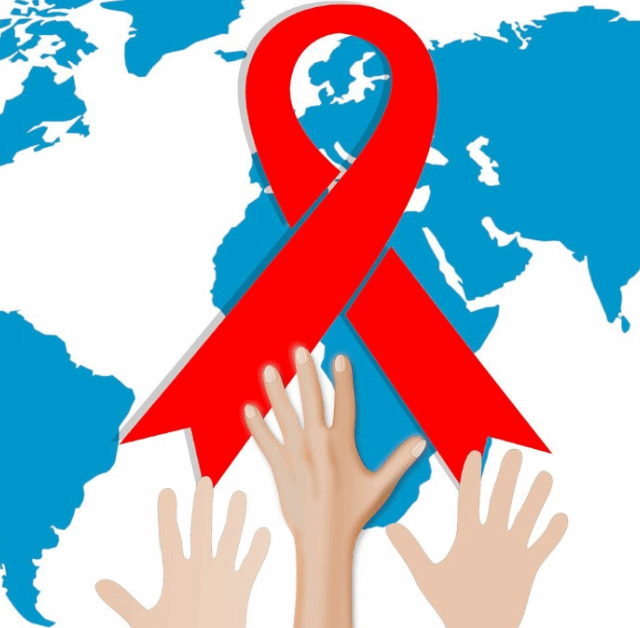HIV/Aids betrifft nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern ist auch eine Frage globaler Gerechtigkeit. Trotz großer Fortschritte in vielen Ländern bleibt das Virus für Millionen Menschen eine Bedrohung, besonders für Frauen und Mädchen in Subsahara-Afrika.
Ein Blogbeitrag von ONE-Jugendbotschafterin Milona Msgna Weldemariam
Im ersten Teil dieser Mini-Serie habe ich mit Maisha e. V. gesprochen, einem Gesundheits- und Sozialzentrum für afrikanische Migrant*innen in Frankfurt am Main. In Teil zwei betrachte ich die internationale Ebene und die politische Verantwortung im Kampf gegen HIV/Aids gemeinsam mit Sophia Schoeneberg, Pressesprecherin des Globalen Fonds in Deutschland.
Wer ist der Globale Fonds?
Der Globale Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria wurde 2002 gegründet und ist heute der größte multilaterale Geldgeber für Gesundheit in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Er mobilisiert jährlich rund fünf Milliarden US-Dollar und hat seit seiner Gründung über 69,9 Milliarden US-Dollar in Programme gegen die drei Krankheiten und zur Stärkung von Gesundheitssystemen investiert.

Welche Fortschritte konnten durch den Globalen Fonds beim Kampf gegen HIV und Aids erzielt werden und wo stehen wir heute?
Sophia Schoeneberg:
Die Partnerschaft des Globalen Fonds spielt bei der Bekämpfung von HIV/AIDS eine zentrale Rolle: Rund 26 Prozent aller internationalen Finanzmittel für HIV-Programme stellt der Globalen Fonds bereit. Und die daraus finanzierten Maßnahmen zeigen Wirkung. Seit der Gründung im Jahr 2002 sind die AIDS-bedingten Todesfälle in den Partnerländern um 74 Prozent und die Neuinfektionen mit HIV um 62 Prozent zurückgegangen (Stand Ende 2024) – ein bemerkenswerter Erfolg.
Trotz dieser Fortschritte bleibt viel zu tun. Im Jahr 2024 gab es weltweit 1,3 Millionen Neuinfektionen, und rund 630.000 Menschen starben an den Folgen von HIV – das ist noch immer mehr als das Dreifache dessen, was sich die internationale Gemeinschaft als Ziel gesetzt hat.
Besonders gefährdet sind weiterhin Menschen, die unter gesellschaftlicher Ungleichheit, Armut oder Diskriminierung leiden – und dadurch oft keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung haben. Um AIDS nachhaltig zu besiegen, arbeitet der Globale Fonds deshalb gezielt daran, menschenrechts- und geschlechterbezogene Barrieren abzubauen. Dazu gehören der Ausbau von Testangeboten, der Schutz besonders gefährdeter Gruppen sowie eine Versorgung, die sich stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen der Betroffenen orientiert.
Gleichzeitig hat es in den vergangenen Jahren bedeutsame Fortschritte in der HIV-Prävention und -Behandlung gegeben. Dazu zählen der Dapivirin-Vaginalring, das langwirkende Präventionsmittel Cabotegravir und innovative Medikamente wie Lenacapavir. Gerade diskrete und langwirksame Präventionsmethoden können einen entscheidenden Unterschied machen, wenn sie breit verfügbar sind. Der Globale Fonds unterstützt deshalb nicht nur die Herstellung und Bereitstellung dieser Präparate, sondern setzt sich auch dafür ein, Preise zu senken und den Zugang in Ländern mit hoher HIV-Belastung zu verbessern – ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer gerechten und Aids-freien Zukunft.
Die Erfolge der vergangenen zwei Jahrzehnte zeigen: Wir wissen, was funktioniert. Das Ziel, AIDS zu beenden, ist heute in greifbare Nähe gerückt. Wir haben die historische Chance, eine Pandemie zu überwinden, die bereits über 42 Millionen Menschenleben gefordert hat. Eine AIDS-freie Generation ist möglich – ihr Erreichen hängt jedoch entscheidend vom politischen Willen, internationaler Solidarität und von ausreichender finanzieller Unterstützung ab.
Warum sind gerade Frauen und Mädchen in Subsahara-Afrika besonders gefährdet?
Sophia Schoeneberg:
In Ost- und Südafrika sind Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren weiterhin einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, sich mit HIV zu infizieren. Allein im vergangenen Jahr haben sich in dieser Altersgruppe schätzungsweise 210.000 Mädchen und junge Frauen mit dem Virus angesteckt – im Vergleich zu rund 160.000 Jungen und jungen Männern.
Die Gründe dafür sind vielfältig, aber gut bekannt: Geschlechterungleichheit, eingeschränkter Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, Diskriminierung und geschlechtsspezifische Gewalt erhöhen nicht nur das Infektionsrisiko, sondern hindern viele Mädchen und Frauen auch daran, Präventions-, Behandlungs- und Hilfsangebote wahrzunehmen. Hinzu kommt, dass viele von ihnen nicht selbstbestimmt über ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit entscheiden können – ein strukturelles Problem, das die Epidemie weiter antreibt.
Trotz dieser Herausforderungen gibt es Grund zur Hoffnung: In den letzten Jahren sind die Neuinfektionen unter Mädchen und jungen Frauen deutlich zurückgegangen. Möglich wurde das durch den Ausbau von HIV-Tests und -Behandlungen, einen besseren Zugang zu modernen Präventionsmitteln, gezielte Aufklärungsprogramme und starke, von Gemeinschaften getragene Initiativen. Allein im vergangenen Jahr konnten in den Partnerländern des Globalen Fonds rund 2 Millionen Mädchen und junge Frauen HIV-Präventionsdienste in Anspruch nehmen.
Entscheidend ist, dass diese Programme konsequent fortgeführt und weiter ausgebaut werden – denn sobald wir nachlassen, droht das Virus rascher zurückzukehren. Das würde nicht nur gesundheitliche Rückschläge bedeuten, sondern auch deutlich höhere Kosten in der Zukunft verursachen.
Deutschland zählt zu den wichtigsten Unterstützern des Globalen Fonds – über 5 Milliarden Euro hat die Bundesregierung bislang beigesteuert. Mit dem aktuellen Beitrag von 1,3 Milliarden Euro unterstützt Deutschland nicht nur die HIV-Bekämpfung, sondern auch den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme.
Doch mögliche Kürzungen könnten fatale Folgen haben. „Wenn man im Kampf gegen Krankheiten wie HIV, Tuberkulose oder Malaria nachlässt, breiten sie sich wieder aus“, warnte Peter Sands, Geschäftsführer des Globalen Fonds, kürzlich in der taz. Die Pandemieprävention der Zukunft hängt entscheidend davon ab, dass Länder wie Deutschland ihre Zusagen einhalten.